Susanne Tägder: Die Farbe des Schattens – Ausnahmeerscheinung?
Mit „Die Farbe des Schattens“ legt Susanne Tägder den zweiten Teil ihrer Serie um den Ermittler Arno Groth vor, auch wenn das verwirrenderweise nicht so gelabelt ist. Über weite Strecken gelingt der Autorin damit ein ungewöhnlicher Blick hinter die Ost-Kulissen mit großer Bravour.
Setting & Story
Die Handlung des Buchs führt Leser in den Osten Deutschlands. 1992, kurz nach der Wende, als dem Freudentaumel das Gefühl des Ausverkaufs weicht und Arbeitslosigkeit und Identitätsverlust eine große Rolle spielen.
Und da verschwindet ein Junge aus einer „Platte“ und wird später ermordet aufgefunden. Arno Groth, der mit anderen privaten Problemen zu kämpfen hat, übernimmt die Ermittlungen und führt uns dabei mit viel Hingabe in ein Labyrinth aus rechten Schlägertypen, dem Verfall, einem Haufen kleiner Leben, die allesamt ihre eigenen Kämpfe zu kämpfen haben. Das Ganze ist großartig beschrieben und lässt uns den Menschen extrem nahekommen. Mehr als vielen der Ermittler in diesem Fall.
Neben dem Hauptdarsteller bleiben viele der anderen Polizisten farblos. Generell gilt: Das Buch ist als „Kriminalroman“ gelabelt. Und das ist sicherlich eine bewusste Entscheidung. Es ist ein Roman mit einem großen „Krimi“-Anteil, aber echte Krimileser werden hier vielleicht das Tempo der Ermittlung ein wenig vermissen.
Das ist sicherlich Geschmackssache. Das Buch passt an der Stelle einfach nicht in die eine oder die andere Schublade. Das könnte schiefgehen, tut es aber nicht. Susanne Tägder gelingt es vielmehr, beide Schubladen zu füllen.
Sprache und Spannung
Das Buch ist sprachlich auf eine sehr eigene Weise brillant. Es ist präzise, vermeidet Ausschweifungen oder sinnlose Metaphernakrobatik. Stattdessen ist es vielmehr deskriptiv. Beobachtend, beschreibend und es wechselt die Kamera-Perspektive von der Totalen bis in die Nachaufnahme. Und das wirklich gekonnt und immer wieder an der richtigen Stelle. Obwohl in Phasen nicht straff ermittelt wird, entstehen keine Längen.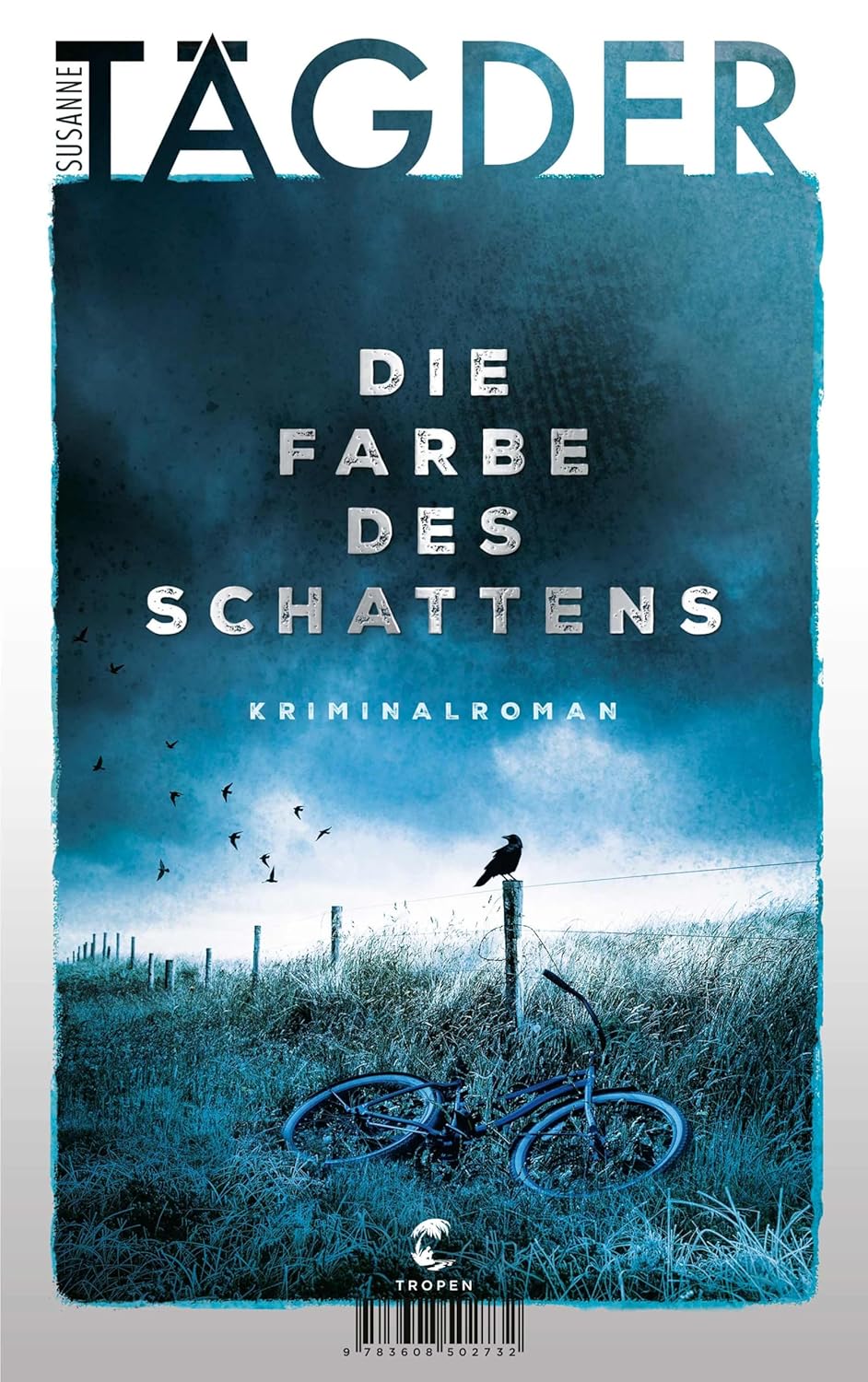
Einiges jedoch ist verwirrend. Die Handlung spielt in einem fiktiven Ort. Später erfährt man, dass jemand an einem anderen fiktiven Ort im Urlaub war. Der heißt Braunlage, wie ein real existierender Ort, nur, dass der eben im Westen lag und nicht im Osten. Das schmeckt irgendwie fad. Weit schwieriger erschien uns beim Lesen die ständige Angabe von Straßennamen. Die Autorin lässt Arno durch Straßen laufen, die in einem fiktiven Ort liegen. Straßen, die man auf keinem Atlas der Welt anschauen kann. Aber sie nutzt diese Angaben ständig als geografische Beschreibung. Ganz so, als würde dem Leser das in irgendeiner Weise helfen.
Das ist am Anfang anstrengend, irgendwann wird es störend, weil es vorgaukelt, eine Information zu geben, die jedoch keine ist. Und das passiert in einigen Phasen in hoher Frequenz.
Die Auflösung des Falles ist seltsam blutleer. Und so schwankt das Bild zwischen einem in Phasen unglaublich guten, gefühlvoll geschriebenen Buch mit einigen tollen Figuren in seinen Höhen und Stolpersteinen in seinen Tiefen. Am Ende folgt ein Nachwort, in dem die Autorin sich auf ein wichtiges Zitat im Zusammenhang mit der Entstehung des Buches „Die Geschichte der Magd“ bezieht. Ein solches Buch gibt es nicht, der deutsche Titel lautet vielmehr „Der Report der Magd“. Das schmeckt ebenso seltsam wie zwei kleine vermeidbare historische Fehler in dem Werk, das ansonsten enorm gut recherchiert erscheint.
Fazit
In seinen guten Phasen ist das Buch eher 110 Punkte wert. Selten haben wir ein so gefühlvoll geschriebenes Werk über Deutschland nach der Wende in den Finger gehalten. An den Stolperstellen ist es verwirrend und anstrengend. In Summe ist uns das 88 Punkte wert. Und eine volle Lese-Empfehlung.
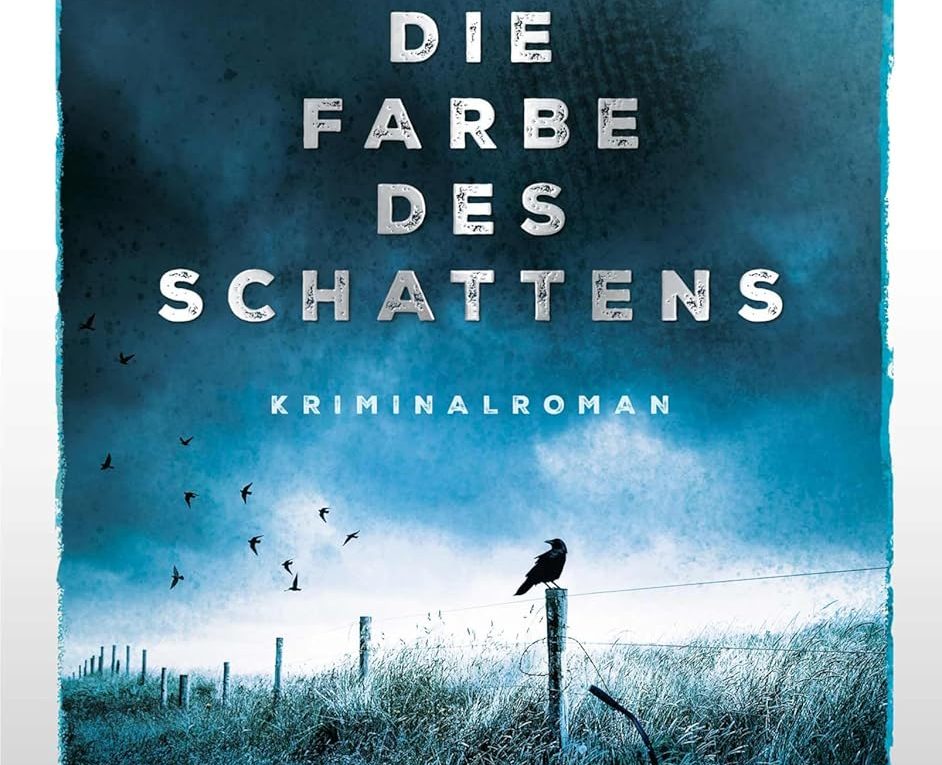
Starkes Review! Danke für den Einblick. Zwar war mir dieses Bewertungssystem bis vor 5 Minuten noch fremd aber es erscheint nachvollziehbar. Insofer sind 88 Punkte wohl eine Ansage.
Dass der Krimi-Plot eher im Hintergrund steht, stört mich meistens gar nicht, wenn die Atmosphäre stimmt.
Aber das mit den fiktiven Straßennamen und dem falschen Buchtitel im Nachwort klingt schon etwas schräg. Findest du, dass solche Details den Lesefluss massiv stören, oder kann man über die „Stolpersteine“ hinwegsehen, weil die Sprache an sich so brillant ist?